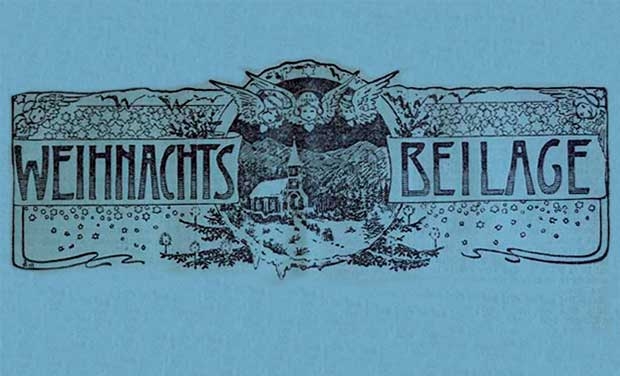In der heiligen Nacht
Eine Weihnachtsgeschichte von Karl Hans Strobl
06.12.2024
Der Bäuerin auf dem Plutzerhof wird das Arbeiten schwer, in der eingefallenen Brust kocht mühselig der Atem. Da will die Arbeit gar nicht mehr recht von den matten Händen gehen, die sinken ihr oft mitten im Schaffen herunter. Dann sitzt sie oft auf der Bank, den Kopf an die Wand gelehnt, oder taumelt gar in die Kammer, fällt aufs
Bett, schließt die Augen und schwimmt ins Nichts.
Wenn sie aber den Bauern hört, dann rafft sie alle Kraft zusammen, zwingt das flackernde Herz, taumelt auf, greift wieder zu. Kann aber doch in die traurigen Augen das Lächeln nicht zwingen, das der Bauer darinnen sucht, und auf die Lippen kein Lachen und in ihren Schritt keine Munterkeit.
Das Lächeln, das Lachen und das heitere Schreiten bleibt schon der Ritschi, der Jungdirn, mit ihren achtzehn Jahren und den braunen Zöpfen, den weißen Zähnen hinter roten, geschwungenen Lippen, dem sauberen Gangwerk und den breiten Schultern. Sie ist ein Mädel aus der Freundschaft, von der armen Seiten her, von Häuslersleuten, die von der Hand in den Mund leben. Und seitdem sie im Haus ist, ist sie wie der leibhaftige Frühling zwischen dem griesgrämigen Winter und dem welken Herbst der Bäuerin. So muss die Bäuerin schon einsehen, dass es dem Bauern, jung, fest, gesund wie er ist, das Gesicht immer zum Frühling hinüberdreht als zum Herbst, wenn er sich auch nichts merken lassen will und der Bäuerin nichts als gute Worte gibt: Sie soll halt die Dirndln schaffen lassen und sich nicht übernehmen. Aber bitter ist das, gallenbitter, und oft, wenn die Bäuerin mit ihren zwei Kindern allein ist, nimmt sie das Mädel an’s eine, den kleinen Buben an’s
andere Knie, drückt sie sich, und dann fallen heiße Tropfen auf die zwei blonden Köpfeln, dass die Kinder verwundert fragen: „Mutter, wos wanst?“
Kein Wunder ist auch, dass der Knecht immer glänzende Augen kriegt, wenn die Ritschi vorübergeht, dass ihm beim Heuaufladen oder beim Misten die Gabel immer noch einmal so leicht wird oder beim Mähen die Sense einen besonderen Schwung
kriegt, wenn sie dabei ist. Aber auch die andern jungen Burschen im Dorfe sind nicht blind für das Stück jungfrisches Mädeltum im Plutzerhof. Es sind sogar etliche Bauernsöhn’ darunter, die beim Tanzen die Ritschi aufführen, wenn sie auch nur ein dienendes Dirndl ist und von Häuslersleuten. Und ein und das anderemal ist unter der Ritschi ihrem Kammerfenster ein Getue und Gemache gewesen, als hätt’ die Finsternis Gestalt und Stimm’ bekommen und wollt’ was von dem Dirndl. Bis der Bauer einmal dem Matthesl, dem Knecht, einen Deuter gibt, auf den er nur gewartet hat: dass dem Bauern nicht recht ist, wenn die Nacht gar so freundlich und zudringlich wäre. Also geht das nächstemal unter dem Kammerfenster ein Getöse
an, wie von einem halben Dutzend raufender Maikater, aber recht großer, und damit ist dann weiterhin Ruh gewesen, wenn auch der Matthesl am nächsten Tag ein blaues Aug’ gehabt hat.
Indessen geht die Ritschi mit ihren festen Schritten durch die Tage, kümmert sich um nichts, ist mit allen gleich freundlich und je weniger einer bei ihr erreichen kann, desto mehr ist er hinterdrein und desto ernster wird’s ihm damit, weil er sieht, das Dirndl ist nicht zum Spaßmachen da.
Gegen den Winter wird der Bauer recht unstet, verliert leicht die Geduld, brummt im Haus herum, murrt auch manchmal die Bäuerin an und ist nur still, wenn die Jungdirn um den Weg ist. Manchmal packt er sich zusammen und geht ins Wirtshaus oder fahrt in die Stadt und über all dem werden die Augen der Bäuerin
nur immer trauriger und wird ihr Schaffen immer müder und matter.
No, so geht sie einmal die Stund’ Weges nach Willenz hinüber, wo die Ritschi zu Haus ist, und sucht die Häuslerleut’ heim, hat aber niemandem was davon gesagt, wohin sie geht und warum. Ist ihr schon der Hinweg recht schwer geworden, so ist’s auf dem Rückweg noch ärger, kommt die Bäuerin nur mühsam vom Fleck, muss öfter stehen bleiben und sagt sich, sie hätt’ sich halt wirklich zuviel getraut.
Wie sie auf der beinhart gefrorenen Straße sich vorwärts schleppt, sieht sie auf einmal im hellen Mondschein ein kleines Büscherl Stroh vor ihren Füßen hinlaufen. Obzwar sich kein Windhauch rührt, rollt das Strohbüschel doch, als ob es getrieben würde, immer vor der Bäuerin her und kommen aus dem Halmwerk ein leises, feines Wimmern und Greinen, ein Schluchzen und Stöhnen, dass es die Bäuerin von innen heraus eiskalt überläuft.
Am Kreuzweg ist das Bündel so plötzlich verschwunden, wie es gekommen ist, und die Bäuerin, hingeworfen vor dem Kruzifix, fasst den Stamm mit beiden Armen und weint ihren ganzen Jammer heraus: „O, du mein Heiland, so hab' ich die Klagemutter müssen sehen und über mich greinen hören. Und so weiß ich, was über mich beschlossen worden ist und dass ich aufs Jahr unter der Erden bin. So möcht' ich doch, mein Herr und Heiland, noch die letzte Zeit meinen Frieden haben, und nicht zuschauen müssen, wie meinen Mann das innere Feuer frisst und er sogar seine Festigkeit verliert. Möcht’ auch nicht, dass es dem Dirndl ans Herz greift, und dass sich unter meinem Dach die Schand’ breitmacht. Heut ist es noch unangerührt davon, aber mit so einem jungen Menschen ist’s wie mit einem Heustadel: Durch einen einzigen Funken kann’s Unglück geschehen sein. Und möcht’ doch auch wieder nicht das brave Mädel unter fremde Leut stoßen, die ungut zu ihm sind, so lass, barmherziger Gott, was ich angefangen hab’, zu einem glücklichen End’ kommen ... ich bitt' dich darum, um deine heilige Mutter und um die sieben Wundmale und deinen Tod am Kreuz ...“
Etliche Tag’ nachher kommt dle Post von den Häuslerleuten, die Ritschi möcht’ am nächsten Sonntag bei ihnen einsprechen, sle hätten ihr was zu sagen. Der Bauer und die Bäuerin haben nichts dawider, so macht sich das Dirndl auf, geht heimzu und ist am Abend wieder zurück.
„Was hat’s geben?“ fragt der Bauer. „A nix!“ sagt die Ritschi, aber schaut dabei den
Bauern nicht an, schaut überhaupt immer an ihm vorbei, ist, wie wenn man sie scheu gemacht hätt’ und nachdenklich. „Was hat die Ritschi?“ fragt der Bauer die Bäuerin, und die gibt die Antwort: „Ich weiß nit,“ aber sie weiß es ganz gut, dass dem Dirndl nur das im Kopf herumgeht, was sie ihm selber hat hineinsetzen lassen. Und zu alledem stimmt’s haargenau, dass etliche junge Leut’ so nach und nach auf den Hof kommen und sich herumdrehen, als wenn sie nicht recht wüssten, wie sie zu der Hacke den Stiel finden sollen. Lassen ihre Augen hinter der Ritschi herlaufen, zwinkern der Bäuerin zu, ob zwischen ihnen und ihr ein Einverständnis wär’, aber an
die, auf die’s abgesehen ist, trauen sie sich nicht so recht, eingedenk dessen, wie’s ihnen früher ergangen ist. Nur der Wagnernazl – jetzt noch Gesell, aber er wird schon einmal ein Eigener werden und kriegt nach seinem Vater das Häusel – der Wagnernazl, was der Couraschierteste ist, lasst einmal gegen die Bäuerin verlauten: „No, was is, Bäuerin, ihr habt’s mir Post sagen lassen wegen der Ritschi ...“
„Nur net z’gach, Nazl,“ sagt die Bäuerin, „a jeder Apfel und a jede Birn braucht ihr’ Zeit zum zeitig werden.“
Dem Bauern wird die Zieherei zuletzt auffällig. „Was isi denn dös für a Gerenn’ und Gelaufe auf unserm Hof?“ fragt er die Bäuerin, „was will denn der Wagnernazl schon zum zweiten Male da? I hab’n net bestellt.“
„Sein Meister wird bald übergeben. Da schaut er halt schon nach der Kundschaft,“ meint die Bäuerin, aber sie merkt, dass jetzt nicht mehr lange hingehalten werden darf. Eingefädelt ist, jetzt muss genäht werden. Zwei Tage vor Weihnachten ist's, da schickt sie die Altdirn, die im Geheimnis ist und ihr den Boten gemacht hat, um die Ritschi: Sie soll zur Bäuerin in die Stuben kommen.
Schafft ihr dann, wie die Ritschi da ist, irgend etwas an und wie die Ritschi wieder gehen will, fragt sie so beiläufig, was denn mit ihr los ist, warum sie so dreinschaut und nicht mehr so gut lachen kann.
Das Mädel will erst nicht recht mit der Sprach’ heraus, wird rot, dreht sich herum, wie ihr die Bäuerin recht herzhaft zusetzt, da tut sie zuletzt einen Seufzer und meint: „Ihr seid’s immer so viel gut zu mir g’wesen, Bäuerin, so muss i euch’s wohl bekennen. Wie mich meine Mutter hat holen lassen, desselbige Mal, hat sie mir halt zug’redt, i soll heiraten.“
„O je!“ sagt die Bäuerin, „das is aber sunst kein Grund zum Kopf hängen lassen.“
„Es sein etliche da, hat die Mutter g’sagt, dreie oder viere, die möchten gar wohl und
überlegten sich’s net lang.“
„Aha!“ sagt die Bäuerin, „da schau her. Drum war so ein lebhafter Einstand auf dem Hof in der letzten Zeit. Das glaub’ i, so a Schafferin wie du bist und a so bildsaubers Dirndl dabei, möcht bald einer in die Wirtschaft haben. No also, Ritschi, greif’ zu.“
„Wann i aber net weiß, welcher als es is,“ sagt die Ritschi, indem sie den Schürzenzipfel vor’s Gesicht zieht, „mir is gar nicht nach dem Heiraten. Wann mir aber halt die Mutter gar so viel zug’redt hat.“
„Wird schon recht g’habt haben, deine Mutter. Wirst doch du ka ledige Dirn bleiben woll’n. Sein ja lauter brave Burschen, die nach dir schau’n.“
„Wenn i aber kan mag !“ sagt die Nitschi ganz trotzig.
Die Bäuerin denkt eine Weile nach. „I wusst’ dir an Rat,“ sagt sie langsam; „in zwei Tagen ist die heilige Nacht ... die zeigt dir den Rechten, glaubst net? Weißt ja, wie's gemacht werden muss. Dann kannst schon im Fasching Hochzeiterin sein.“
„Dös schon, aber i mag net,“ bockt die Ritschi auf. – „Geh' red’ net! Überleg’ dir’s halt!“
Sie müsst’ kein Dirndl sein, denkt die Bäuerin, wenn jetzt nicht die Neugier größer wär’ als ihr Trotz. Und wenn sie einmal in der Weihnacht einen Deuter bekommen hat, sollt’s auch nur ein eingebildeter sein, dann ist sie auf den Weg gewiesen, und so ist’s gut.
Dass die Bäuerin die Menschen kennt, hat sich am heiligen Abend bewiesen, denn wie der Bauer nach dem Abendessen zum Mantel greift und die Bauerin sich ins Tuch wickeit, und wie jetzt alle miteinander zur Metten ins Dorf gehen sollen, da sagt die Jungdirn, sie müsst daheim bleiben, könnt nicht mit, weil sie mit der Arbeit für
morgen nicht fertig wär’. Schaut der Bauer finster drein: es wär’ wohl nicht so gefährlich, aber die Bäuerin meint, man sollt’ dem Dirndl nicht dreinreden, sie wüsst schon, was sie tät, und so bleibt die Ritschi richtig allein im Haus.
Wie die Laterne zum letztenmal zwischen den Fichten aufblinzelt, da ist’s der Ritschi: nicht allein bleiben, schnell nachlaufen! Aber sie derfangt sich; ist’s denn nicht wirklich so: dass sie selber nicht weiß, was sie eigentlich will, warum sie so zerwirrt ist, und was ihr eigentlich Lachen und Singen verschwunden hat? So will sie
wirklich ausprobieren, ob was an dem ist, was die Leut’ von der heiligen Nacht erzählen und ob sie draus wieder in ihr altes Wesen zurückfinden könnt’.
Kramt also in ihrer Unrast zuerst in ihrer Kammer, und wie es gegen Mitternacht geht, steigt sie langsam in die Stuben hinab. Ist halt doch ein Zittern in ihr, denn, was sie tun will, ist nicht ganz ohne Gefahr. Kann einen auch der Tod anschauen, wenn man im künftigen Jahr versterben soll; ist auch ein Bräutigam, wenn es so bestimmt ist. In Gottes Namen fangt die Ritschi an, legt erst den neuen Laib Brot auf den Tisch in der Mitte, das Messer dazu. Warum das so sein muss, weiß die Ritschi nicht, aber es muss so sein. Und jetzt legt sie die Kleider ab, ein Stück ums andere, den Spenzer, die Kitteln, Strümpf und Schuhe; kalt steigt es ihr von unten in den Leib hinauf, so warm auch die Stuben ist. Das Hemd ist das einzige, was sie noch anhat, auch das Hemd mus weg ... nackt, ganz nackt, muss sie die Stuben kehren. Sie schämt sich ganz furchtbar, hat die Nacht nicht hundert Augen, die durch die Fenster starren? Was hilft’s?
Mit einem Ruck zieht sie das Hemd über ’n Kops, sieht da, in ihrer nackten, jungen, schamhaften Schönheit. Und jetzt nur schnell den Besen, den Besen; mit langen, kräftigen Strichen fährt er über den Boden hin, halb betäubt ist die Ritschi, es summt und zischelt um sie, als wäre die Luft voll Stimmen. Und nur nicht nach dem Tisch schauen, wo das Brot liegt, sonst ist alles vergebens gewesen. Ihre Angst treibt sie an, keuchend führt sie den Besen rund um den Tisch, nur nicht hinschauen! Warum sie sich nur eingelassen hat, tausendmal bereut sie ’s schon, sie will ’s ja qar nicht wissen ... warum hat sie Gott versucht?
Aber nun ist 's geschehen, das Zimmer gefegt, nun muss sie über die Schulter zurück zur Tür schauen ... ein Läuten und Brausen ist in ihren Ohren, das Blut schwillt wie ein frühlingsnärrischer Waldbach mit funkelnden Stürzen durch sie hin.
In Gottes Namen, da es einmal soweit ist ... wen wird sie sehen? Strack aufgerichtet sieht sie inmitten der Stube, wendet nun langsam über die Schulter hin den Kopf zur Tür, die Schläfen wie zwischen eiserne Zangen gepresst.
Nichs ... die braune Tür schneidet ein dunkles Rechteck in die weiße Stubenwand. Gottlob ... nichts, ein bissel tief innen war doch die Angst der Vermessenheit, es könnte einen der Tod angrinsen.
Aber geht da nicht die Tür auf, spaltbreit, weicht weiter, lautlos, gähnt auf, kalt weht ’s herüber, und auf einmal steht im dunkeln Grund mit einem matten Leuchten – der Bauer.
Schreit die Ritschi grell auf, springt zur Bank, wo die Kleider liegen, reißt sie an sich, schreit: „Weg, weg!“ Einsinken soll sie in den Erdboden, einstürzen soll das Haus. Nacht soll daherbrausen! Die Schand! Die Schand! Geschen werden so vom Bauern, so ... o Gott ... Was jetzt? Hinter der Angst und Scham wirft sich jetzt der Zorn auf sie: so eine Dummheit von ihr, so eine Niederträchtigkeit von ihm und plötzlich in all dem Tumult in ihr weiß sie es mit jähem, schluchzendem Aufschrei, dass er es ist, dem sie gehört, schon lang, nur ungewusst in ihrer Einfalt.
Wie sie aber jetzt wieder aufzuschauen wagte, da ist der Bauer fort und die Tür steht dunkel in der weißen Wand. Zitternd wirft die Dirn die Kleider um sich, rennt auf ihre Kammer, haut sich aufs Bett, weint in Glück und Scham vor Wut.
Nach einer Weile dann hört sie Gehen in Haus und Sprechen, des Bauern Stimme, die Bäuerin, so sind sie jetzt alle aus der Metten zurück. Nichts sehen, keinen Menschen sehen, vergraben bleiben in der Flnsternis! Aber da tappt’s schon die Stiegen herauf, müde Füße, die Bäuerin steht schon mit dem Licht in der Kammer.
„Na, Dirndl, welcher ist’s?“
Die Ritschi schüttelt den Kopf, mag nicht aufschauen, da rührt sie die Bäuerin an der Schulter an, mit freundlicher Hand. „Welcher ist’s denn, Ritschi?“
Ein tränenüberschwemmtes, verstörtes Gesicht hebt sich aus dem rot und weiß gewürfelten Polster: „Kaner!“
„Hast keinen g’seh’n?“
Kopfschüttelnd schaut die Bäuerin das Dirndl an, das blinzelnd die Augen abwendet in die finsteren Ecken hinein.
„I bitt um mein’ Lohn,“ sagt das Dirndl leise, „auf Neujahr möcht i aus’m Haus!“
Gar nicht zu verstehen ist das, der Bäuerin ist der Faden aus der Hand geglitten, aber sie nimmt's wie's kommt: „So will ich dich net halten, tut mir aber leid, recht leid ...!“
Wie sie schon an der Tür ist, zögert es schwer hinter ihr drein: „Sagt’s, Bäuerin, ist der Bauer erst jetzt mit euch von der Metten heim'kommen?“
„Der Bauer ... freili is er jetzt erst mit mir ...“ Da fängt der Bäuerin das Licht in der Hand zu zittern an, rundherum läuft die Kammer, jäh reißt’s ihr die Brust auf, und mit wilden wehen Augen starrt sie das Dirndl an.
So also ... so ist’s gekommen. Dann hat’s halt so kommen müssen. Ganz still ist die Bäuerin geworden, ganz still lässt sie den Kopf sinken: „So bitt ich dich halt, Dirndl, in Gottes Namen, wenn du deinen Kindern einmal ein Rankerl Brot schneid’st, dann gib auch den meinigen ein Stückl“ –
Um Ostern ist die Bäuerin auf der Schragen gelegen und ihr letztes Wort ist gewesen, wenn der Bauer ihren Kindern eine gute Mutter wollt geben, so sollt er die Ritschi zur Bäuerin nehmen. Und über's Jahr hat der Bauer die Ritschi vom Kerndlhof geholt, wo sie Dirn gewesen, und hat sie zu seiner Bäuerin gemacht.
Und hat die Dirn niemals vergessen, wenn sie ihren Kindern ein Rankl geschnitten hat, auch denen der ersten Bäuerin ein Stückl Brot zu geben.
Aber das hat der Bauer niemals erfahren, dass er schon einmal sein Weib in der heiligen Nacht gesehen hat, wie sich’s nicht gehört.